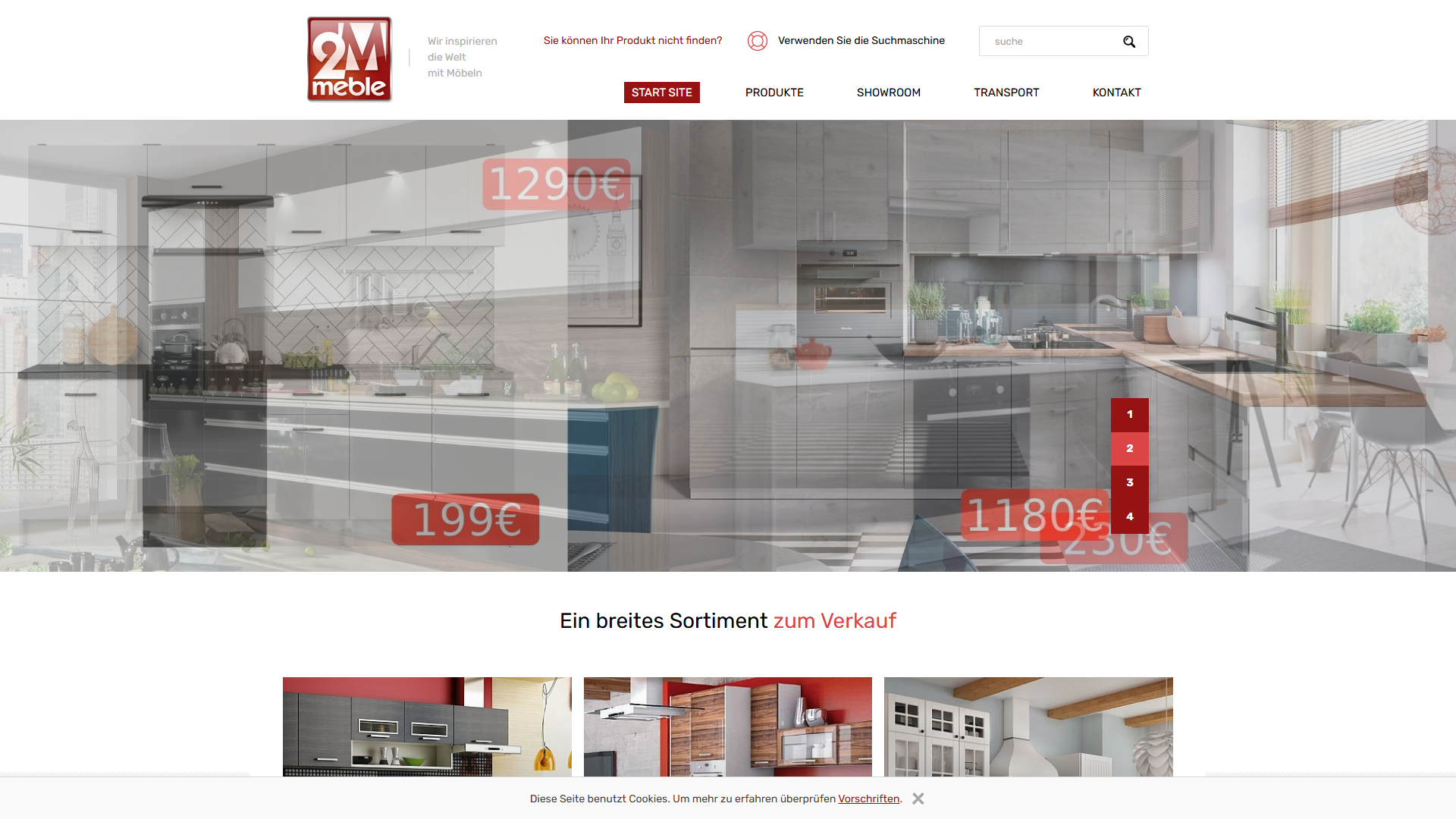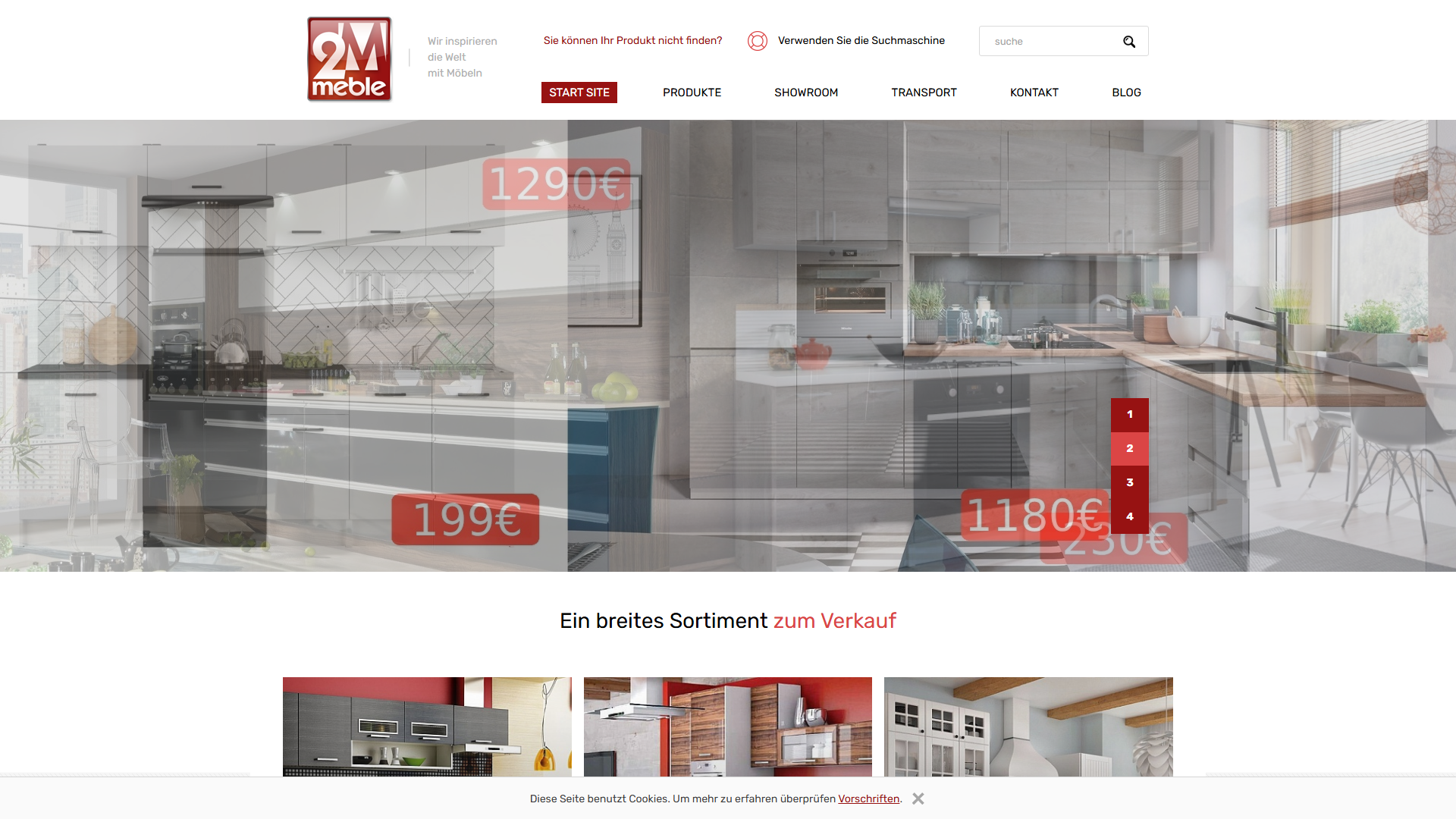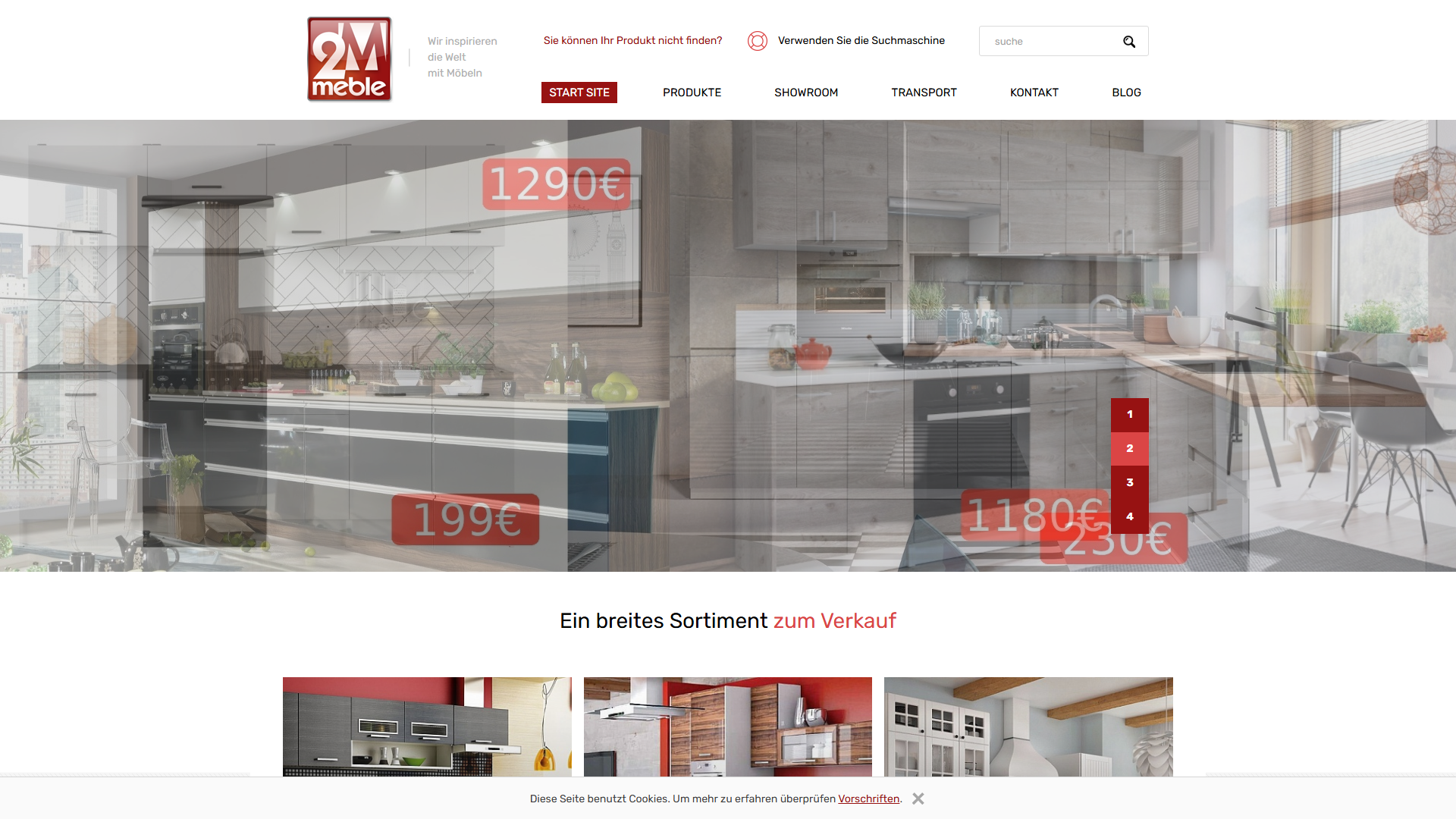Geschichtswerkstatt Ronsdorf
Ein lebendiges Gedächtnis unserer Stadt
Ronsdorf ist mehr als ein hübscher Stadtteil am Rande des Bergischen Landes; für uns ist er ein Kaleidoskop aus Geschichten, Stimmen und Erinnerungen, die sich über fast drei Jahrhunderte erstrecken. Als wir die Geschichtswerkstatt Ronsdorf vor über zwanzig Jahren ins Leben riefen, war unsere wichtigste Antriebskraft die Neugier auf jene scheinbar kleinen Erlebnisse, die in keinem Schulbuch Platz finden: der Geruch nach frischem Öl in den Webereien, das Dröhnen der ersten Dampfmaschinen, das Lachen von Generationen, die auf den Wiesen rund um den Schaberg ihre Feste feierten. Diese Alltagsfragmente wollten wir retten, ordnen und mit der Gegenwart verbinden, weil wir glauben, dass eine Stadt nur dann wirklich Zukunft hat, wenn sie ihr eigenes Echo wahrnimmt. Heute treffen sich in unseren Räumen ehemalige Arbeiterinnen, Schüler, Zugezogene und Alteingesessene, um Fotos zu sichten, Tonbänder zu transkribieren oder einfach Geschichten zu erzählen. Das stetige Summen dieser Gespräche lässt die Wände unseres Archivs leben und erinnert daran, dass Geschichte kein fernes Studienfach, sondern ein pulsierender Teil des täglichen Miteinanders ist. Immer wieder staunen wir darüber, wie ein unscheinbarer Einkaufszettel oder ein handgeschriebener Liebesbrief das große Ganze erhellen kann, weil er intime Einblicke in wirtschaftliche Umbrüche, soziale Kämpfe oder familiäre Traditionen gewährt. Durch solche Fundstücke entsteht ein vielschichtiges Bild, das nicht nur Fakten, sondern auch Emotionen transportiert. Wer einmal eine bleiche Fotografie von 1904 in den Händen gehalten hat, auf der ein Kind mit selbst gebautem Drachen an der Blutfinke steht, spürt augenblicklich die Nähe einer längst vergangenen Sommerbrise. Genau diesen Moment der persönlichen Berührung wollen wir ermöglichen, denn er macht Lust darauf, tiefer zu graben, Fragen zu stellen und der eigenen Herkunft nachzuspüren. So ist unsere Werkstatt zu einem offenen Labor geworden, in dem Gemeinschaft durch Geschichtenerzählen wächst. Jeden Dienstagabend, wenn die Türe quietschend ins Schloss fällt und der Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee die Runde macht, verwandelt sich das Archiv in ein lebhaftes Forum. Neu eingebrachte Dokumente werden sortiert, vergilbte Zeitungsausschnitte in mühevoller Kleinarbeit digitalisiert, und manch hitzige Debatte entbrennt darüber, ob eine Episode wirklich so stattfand, wie sich das einzelne Gedächtnis erinnert. Diese lebendige Auseinandersetzung führt nicht selten dazu, dass bisherige Gewissheiten hinterfragt werden und ein neues, nuancierteres Bild entsteht. Unsere Besucherinnen und Besucher lernen dabei schnell: Geschichte ist niemals fertig, sie schreibt sich im Gespräch fort.
Seit den frühen Nullerjahren haben wir dutzende Projekte verwirklicht, die allesamt dasselbe Ziel verfolgen: Ronsdorfer Geschichte sichtbar und erlebbar zu machen. Wir streifen gemeinsam durch alte Firmengelände, befragen die Nachfahren der Tuchmacher, durchforsten die Matrikelbücher der evangelischen Gemeinde und enthüllen längst vergessene Details über das Leben im Spannungsfeld zwischen Industrie und Natur. Herausragend war etwa unser Projekt „Wasser, Feuer, Faden“, in dem wir den Einfluss der Ronsdorfer Talsperre auf die Textilindustrie nachzeichneten und gleichzeitig erzählten, wie das Element Wasser den Alltag der Bewohner bestimmte – vom Waschtag bis zum Hochwasseralarm. Im Zuge dieses Vorhabens entstanden nicht nur eine aufwendig kuratierte Ausstellung im Bandwirker‑Bad, sondern auch ein Hörpfad, der über QR‑Codes direkt an den Originalschauplätzen abgerufen werden kann. Der Erfolg überraschte selbst uns: Innerhalb eines Jahres haben mehr als fünftausend Menschen den Parcours abgelaufen und uns mit Rückmeldungen versorgt, die wir inzwischen in einem Begleitband verarbeitet haben. Besonders bewegend waren die Schulpatenschaften, bei denen Achtklässlerinnen des Ganztagsgymnasiums jeweils eine ältere Person begleiteten und deren Lebensgeschichte aufzeichneten. Daraus resultierten Podcasts, in denen Dialekte, persönliche Krisen und humorvolle Anekdoten nebeneinanderstehen und ein akustisches Panorama der Stadt ergeben. Dabei zeigte sich immer wieder, wie produktiv der Dialog zwischen den Generationen sein kann: Die Jugendlichen lernten das analoge Leben ihrer Großeltern kennen, während die Älteren plötzlich die Faszination für Smartphones teilten, um Fotos ihrer Jugendjahre auf Instagram zu posten. Unsere Rolle als Moderatoren dieser Begegnungen erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit, denn sie beweist, dass sich Erinnerungskultur nicht im musealen Stillstand erschöpft, sondern durch technologische und soziale Innovation neu belebt wird. Auch das Stadtarchiv Wuppertal arbeitet mittlerweile eng mit uns zusammen, weil wir bewiesen haben, dass bürgerschaftliches Engagement wertvolle Daten generieren kann. Gemeinsam entwickeln wir Standards zur Langzeitarchivierung und erstellen Metadaten, die wissenschaftlichen Kriterien genügen, ohne den Charme der persönlichen Erzählung zu verlieren. So werden aus einzelnen Schicksalen Indikatoren für größere gesellschaftliche Entwicklungen, etwa den Wandel der Arbeitswelt, die Migration nach dem Zweiten Weltkrieg oder die Rolle der Frauenbewegung in den Siebzigerjahren. Dieses komplementäre Vorgehen stärkt nicht nur unsere Glaubwürdigkeit, sondern inspiriert andere Stadtteile, ähnliche Werkstätten zu gründen, sodass ein Netzwerk entsteht, in dem lokale Historie sich wie ein Mosaik zum Bild der Region fügt.
Wer jetzt das Gefühl hat, dass auch seine eigene Geschichte Teil dieses Mosaiks sein sollte, ist herzlich eingeladen, sich einzubringen. Jeden ersten Samstag im Monat bieten wir einen offenen Beratungstag an, bei dem wir alte Briefe, Fotos oder Gebrauchsgegenstände begutachten, ihre Herkunft datieren und bei Bedarf fachgerecht scannen. Selbst wenn die Herkunft eines Gegenstandes unklar bleibt, kann er einen wohltuenden Anstoß liefern, sich gemeinsam auf Spurensuche zu begeben. Darüber hinaus veranstalten wir regelmäßige Stadtteilrundgänge, bei denen wir Hinterhöfe öffnen, Maschinen anschalten oder Lieder anstimmen, die früher über die Hügel hallten. Wer es lieber digital mag, kann unser ständig wachsendes Online‑Archiv durchsuchen, in dem bereits über zwanzigtausend Datensätze abrufbar sind – von Adressbüchern des Kaiserreichs bis zu Flugblättern der Friedensbewegung. Die Plattform funktioniert wie ein lebendiger Organismus: Benutzerinnen kommentieren, fügen eigene Daten hinzu und helfen uns, biografische Lücken zu schließen. Unsere Vision ist es, bis zum 300‑jährigen Stadtjubiläum im Jahr 2041 eine multimediale, frei zugängliche Chronik zu erstellen, die jedem Schulkind ebenso offensteht wie der Forschung. Jede eingesandte Erinnerung, jede Korrektur und jede kluge Frage bringt uns diesem Ziel näher und beweist, dass Geschichte immer dann am lebendigsten ist, wenn sie vielen Stimmen gehört.